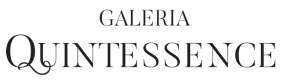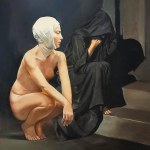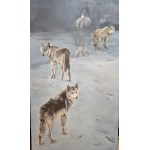Ohne Titel, 1963
Aquarell und Tusche auf Papier, links oben signiert und datiert
Maße: 41,5 x 29,5 cm (Blatt), 32,5 x 50 cm (außen)
Witold-K. (Wit Leszek Kaczanowski), geboren 1932 in Warschau, sein Vater war Feliks Kaczanowski, langjähriger Direktor des psychiatrischen Krankenhauses in Tworki. Seine Kindheit und die Zeit der deutschen Besatzung, die er als Kind hinter den Mauern des Krankenhauses verbrachte, prägen das spätere Werk des Künstlers. "Es gibt keine größere Einsamkeit als die, in die ein Mensch durch eine Geisteskrankheit gedrängt wird", bemerkt Witold K.
Er studierte an der Akademie der Schönen Künste in Warschau an der Fakultät für Grafik. Er war unter anderem Schüler von Eugeniusz Arct, Henryk Tomaszewski und Wojciech Fangor, der sich Jahre später folgendermaßen an ihn erinnerte: "Während der Prüfung kam er auf mich zu und bat höflich, aber bestimmt um die höchste Note. Er hatte keinen Zweifel daran, dass er diese Note bekommen sollte. Nachdem ich seine Arbeit gesehen hatte, hatte ich auch keine Zweifel mehr.
Er schloss sein Studium 1956 ab. Von da an nahm er an Ausstellungen teil, die die jüngste Generation polnischer Künstler präsentierten, darunter die Ausstellung junger bildender Künstler in Warschau (1956) und die Gemäldeausstellung im Nationalmuseum in Warschau (1961). Die erste Einzelausstellung des Künstlers fand im SPATiF-Schauspielerclub in Warschau statt (1959). Im selben Jahr wurde er als Schöpfer des Wandgemäldes im Kulturzentrum Oświęcim ausgewählt, das zu den größten Gemälden seiner Art in Europa zählt. In seinem Werk ging Witold K. kühn über die traditionellen Formen der Malerei hinaus und schuf Skulpturen, Plakate und Theaterkulissen.
Im Jahr 1964 ging er dank eines Stipendiums des Ministeriums für Kultur und Kunst der Volksrepublik Polen nach Paris. Er brachte ein Manuskript von Stanisław Cata-Mackiewicz aus Polen mit, das daraufhin von der Pariser "Kultura" veröffentlicht wurde. Das Sicherheitsbüro erfuhr davon, was dazu führte, dass Witold viele Jahre lang nicht mehr in sein Land zurückkehren konnte. In Paris geriet er in den Kreis der künstlerischen Bohemiens. Unter anderem freundete er sich mit dem Schriftsteller und Dichter Jacques Prévert an, der ein Gedicht über seine Kunst schrieb. Durch Prévert lernte er Pablo Picasso kennen, der ein Porträt des Künstlers malte. Zu den Menschen, mit denen er in Kontakt kam, gehörte auch Françoise Sagan, die bedeutendste französische Schriftstellerin der Nachkriegszeit. Witolds erste Ausstellung im Ausland fand in der Galerie 3 + 2 statt und überraschte die französischen Kritiker mit Lob. So schrieb Philippe Caloni in der Zeitschrift Pariscope: "Diese verstörenden Gemälde sind eine der größten Errungenschaften der zeitgenössischen Kunst, und ihr Schöpfer ist einer der größten Maler von morgen".
Im Jahr 1968 beschloss er, in die USA zu reisen. Seine erste Station war New York. Ein Jahr später zog er nach Kalifornien, wo er in Los Angeles seine erste Studio-Galerie eröffnete. Er lebte und arbeitete auch in Santa Fe und Denver, wo er seit 1980 lebte. "Dort spürt man die Kraft des Raumes", sagt der Künstler. Während seines Aufenthalts in den USA entstanden neue Serien wie Black Holes, Green Holes, Lines und die berühmte Solitude. Ein Motiv, das einer vom Künstler beobachteten Situation entnommen ist: New York, ein Schaufenster mit Luxuspelzen, im Hintergrund ein zusammengekauerter Obdachloser, der auf dem Bürgersteig sitzt. In den folgenden Gemälden dieser Serie entsteht eine symbolische Figur, die keine Erkennungsmerkmale, keine anatomischen Details und nur wenige geometrische Formen aufweist und eine Metapher für Verlassenheit und Einsamkeit darstellt.
Zuletzt angesehen
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen
Favoriten
Bitte melden Sie sich an, um die Liste der Lose zu sehen